Digitales Bauunternehmen
“Die Frage ist nicht, ob Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse elektronisch unterstützen, die Frage ist, wo bringt es Ihnen bei Ihrer Arbeit für Ihren Kunden den größten Nutzen. Wenn Sie genau dort ansetzen, können Sie schnell Erfolge erzielen.”

Die Frage ist nicht, ob Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse elektronisch unterstützen, die Frage ist, wo bringt es Ihnen bei Ihrer Arbeit mit Ihren Kunden den größten Nutzen. Wenn Sie genau dort ansetzen, können Sie schnell Erfolge erzielen.
„Die schnellen Unternehmen werden die großen Unternehmen überflügeln…“
Eine zwingende Grundlage für digitale Betriebsabläufe sind eindeutig definierte Geschäftsprozesse und einheitlich strukturierte Informationen, denn nur dann können Computer Routinearbeiten sinnvoll unterstützen.
Hierzu hielt Peter Rösch auf einer Fachtagung einen Vortrag:
Digitale Betriebsabläufe
dargestellt am Beispiel eines Unternehmens der Bauindustrie.
Die meisten Prozesse in projektorientierten Unternehmen sind durch ihre logistische und betriebswirtschaftliche Komplexität auch auf andere Unternehmen übertragbar.
Für die deutsche Wirtschaft bietet das Informationszeitalter neue Chancen. Schnelle und sichere Informationen werden zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil in allen Projektphasen. Die Organisation des Datenflusses im digitalen Baubetrieb ist ein Schwerpunktthema des AKIM (Arbeitskreis Informationsmanagement im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie).
Als Ergebnis werden der Bauindustrie und allen an der Bauausführung Beteiligten Hinweise zum Aufbau strukturierter Informationen gegeben. Strukturierte Informationen sind die Grundlage der digitalen Betriebsabläufe.

Strukturierte Information
Eine strukturierte Information setzt sich aus einzelnen Daten zusammen, die in ein festgelegtes Raster (Beispiel: Karteikarte) eingetragen werden. In einer strukturierten Information stehen gleiche Dateninhalte an gleicher Stelle.
Mit Einführung der neuen Softwaregeneration auf Basis von Client-Server-Technologien wurde die Hoffnung auf eine integrierte Informationsweitergabe innerhalb des ganzen Projektprozesses geweckt. In der Realität hat der elektronische Informationsaustausch im Bauwesen noch viele Lücken. Dies scheitert weniger an den verfügbaren Technologien der IuK (Informations- und Kommunikationstechnologie), sondern am Willen der am Bauprozess Beteiligten, Daten in strukturierter Form zu organisieren.
Zwei Sichten auf die Informationen treffen in der Bauindustrie aufeinander:
- Die Projektsicht
- Die Unternehmenssicht
Idealerweise greifen beide Sichten auf die identischen Ausgangsdaten zu. Informationen werden somit geholt und nicht gemacht.
Die zwei Sichten
Die Sicht auf die Informationen des Projektes bringt alle an einem Projektprozess Beteiligten zusammen. Die Besonderheit ist, dass oftmals keine direkten vertraglichen Beziehungen bestehen (Beispiel: Statiker – Bauunternehmen) und kein Zwang für eine gemeinsame Informationsstruktur vorliegt.
Aus der Unternehmenssicht werden die Informationen verschiedenartiger Projekte zu gemeinsamen Informationen des Unternehmens zusammengeführt.
- Kapazitätsplanung Großgeräte
- Liquiditätsbedarf
- Ergebnis einer Sparte
Innerhalb eines Unternehmens kann eine gemeinsame Informationsstruktur verfügt werden.
Die Aufgabe des Konzepts „Der digitale Betriebsablauf“ ist die Verbindung beider Sichtweisen und die Verknüpfung der Informationen aus Projekt- und Unternehmenssicht in eine Informationskette. Damit dies gelingt, sind alle Informationen in einem ganzheitlichen und durchgängigen Ansatz zu organisieren. So ist eine Konsolidierung der beiden Sichtweisen und eine gesicherte Weiterverwendung in digitalen Systemen möglich.
Die Sicht des Projektzyklusses
In den einzelnen Stadien des Projektzyklusses treten Informationen in verschiedenster Form auf. Informationen werden in Gruppen beschrieben:
- Vertragsinhalte
- Planung und Konstruktion
- Technische Berechnungen und Beschreibungen
- Optische und Akustische Dokumentation
- Termine und Aufgaben
- Notizen, Protokolle …
- Rechnungswesen
- Beschaffung, Logistik
- Mengenermittlung, Abrechnung …
Eine entscheidende Besonderheit bei allen Datenflussmodellen des Projektprozesses ist die Abhängigkeit von der Zeitachse. Deshalb sind alle Informationen innerhalb des Projektzyklusses an einen Projektablaufplan zu knüpfen. Mit welchen Techniken dieser arbeitet (verknüpfter Balkenplan, Netzplantechnik,…) ist eine technische, weniger eine fachliche Frage.
Die in der Deutschland, federführend durch verschiedene Normungsgremien angedachten Prozesse haben aus praktischer Sicht einen Engpass: Sie greifen Teilprozesse heraus, denken national und aus Sicht öffentlicher Auftraggeber.
Die Planungsphase
In der Planungsphase werden in Abhängigkeit des Anspruches der Gebäudenutzung und Architektur, des Verkehrsaufkommens und verfügbarer Flächen oder bei Kraftwerken Umweltgegebenheiten und Leistungsanforderungen geplant. Aus dieser Planung heraus wird die Konstruktion entwickelt und in weiteren iterativen Prozessen verfeinert. Eine Änderung der verfügbaren Fläche führt immer zu einer Änderung der Planung. Die Regeln hierzu sind dokumentiert.
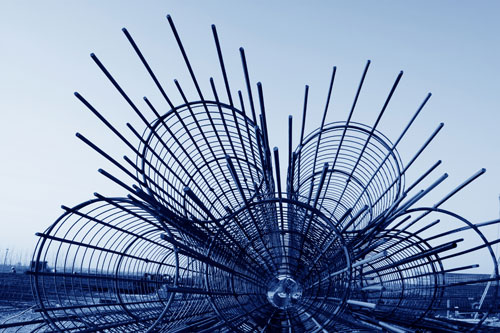
Die Vertragsphase
Die Bestandteile des Vertrages sind Leistungsbeschreibung, Pläne, Terminplan und Leistungsverzeichnis. In der Vertragsphase wird aus den planerischen und konstruktiven Vorgaben mit einer erhöhten Präzision gegenüber der ersten Kostenschätzung und/oder -planung gearbeitet. Gegebenenfalls erfolgen Ausschreibung und Vergabe an Unternehmen, Konsortien, Nachunternehmer und Fachingenieure. Hierbei werden die in der logischen Kette bestehenden alphanumerischen und damit verknüpften konstruktiven grafischen Daten weiter genutzt und detailliert (Durchgängiges 3D-CAD für Planung, Konstruktion, Vermessung, Ausbau und Ausrüstungstechnik).
Beispiel:
Die Ausschreibungsmenge im Leistungsverzeichnis für eine Fußbodenleiste ist die Verknüpfung aus einer Menge mit der qualitativen Leistungsbeschreibung und den detaillierten Hinweisen aus fachlichen Vorschriften (DIN, CEN, …). Die hierin verwendete Menge ist eine logische Verknüpfung aus CAD-Mengen, aus der Leistungsbeschreibung und den sich ergebenden verknüpften gewerkespezifischen Abrechnungs- und Aufmaßvorschriften.
Die Ausführungsphase
In der Ausführungsphase greifen in der Arbeitskalkulation die Verknüpfungen auf Ressourcen (Arbeitskräfte, Material, Geräte, Nachunternehmerleistungen …). Diese werden im Auftragsfalle für die weitere Bearbeitung des unternehmensinternen Bestellwesens (Lieferscheinkontrolle, Rechnungsprüfung) zur Verfügung gestellt. Das Bestellwesen wiederum versorgt Materialnachweise mit Lieferinformationen und gibt diese auch für weitere Aktivitäten im Bereich des Facility Managements vor.
Die Arbeitsvorbereitung und der Projektablaufplan
Die einzelnen Aktivitäten zur Erzielung der vertraglich vereinbarten Leistung sind in Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis nicht beschrieben. Die Formulierungen und der Gebrauch des Leistungsverzeichnisses dient der vertraglichen Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Deshalb werden Leistungsverzeichnis-Positionen in ausführbare Teilleistungen aufgeteilt und zugeordnet. Diese Teilleistungen tragen bereits Informationen über einen logischen Bauablauf und die Verkettung mit anderen Teilleistungen. Auch hierbei wird auf logische Bauobjekte zugegriffen.
Beispiel 1:
Die Teilleistung Ausschalen einer Ortbetonwand trägt die Information, dass sie üblicherweise nach dem Abschluss des Betoniervorganges, gegebenenfalls mit einem Zeitversatz erfolgen sollte.
Beispiel 2:
Die Teilleistung Rohmontage eines Sanitärobjektes trägt die Information, dass sie vor Durchführung der Verputzarbeiten durchzuführen ist. Die Teilleistung Fertigmontage des Sanitärobjektes trägt die Information, dass sie nach Durchführung der Malerarbeiten und/oder nach Durchführung der Fliesenlegerarbeiten erfolgt.
Diese Informationen werden gleichzeitig mit einem wesentlichen Faktor, dem des Bauteiles verknüpft. Als Bauteile gelten einzelne oder hierarchisch gegliederte Orte und Teile eines Bauwerkes. Dies kann ein Raum sein, dies kann ein Stockwerk sein, dies kann im Kanalbau eine Haltung sein, das kann im Gleisbau eine Weiche sein und im Straßenbau eine Fahrspur. Die Gliederungstiefe der Bauteile entscheidet die Auswertungstiefe für
- Mengenermittlung
- Termine
- Ressourcen
- Materialnachweisen

Das Facility Management
Aus der Dokumentation über das Lieferscheinwesen der tatsächlich eingebauten Materialien stehen Informationen im Facility Management FM zur Verfügung. Gleichzeitig stehen dem FM über die bauteilorientierte Mengenermittlung und die zusätzlich in der CAD vorhandenen Geometrien und die Leistungsbeschreibung der Qualitäten zur Verfügung. Somit kann die Nutzung des Facility Management auf diese Grundinformationen zugreifen und die Einrichtung zufügen.
Ebenfalls steht im Facility Management die Konstruktion der Räume und / oder Konstruktion der Versorgungsleitungen, der Infrastrukturobjekte zur Verfügung.
Der Abriss
Das Ende eines jeden Projektes ist der Abriss. Eine Umnutzung stellt nichts anderes als eine Neuauflage des Planungsprozesses und des Projektzyklusses dar. Im Abriss (Rückbau) werden Informationen über Abmessungen, Materialbeschaffenheiten und Konstruktion zur Verfügung gestellt.
Die Unternehmenssicht
In den Unternehmen steht die Aufgabe an, alle Informationen in strukturierter Form zu organisieren. Dies ist die Voraussetzung für eine effiziente Nutzung heutiger IuK-Technologien und Sicherstellung von sicheren und schnellen Informationen für die Steuerung des gesamten Unternehmens. Die Liquiditätsplanung und Beschaffung stehen hier als Beispiele dieser Informationen.
Diese Information, die zu einer Steuerung der Vitalfunktion des Unternehmens gehört, bedarf vorab großer Disziplin. Konsequentes Pflegen des Projektablaufplanes mit kompletter Abbildung des Ressourcenbedarfes und Konsolidierung aller Einzelinformationen der Projekte zur Unternehmens- oder Spartensicht.
Die Beschaffung
In Einkauf und Rechnungswesen liegen Potentiale, den gesamten Beschaffungsprozess verwaltungstechnisch zu optimieren. Erfolgt der Materialbedarfsauszug aus der Angebots- und / oder Arbeitskalkulation automatisch über eine stammdatengestützte Kalkulation, können diese Artikel bereits mit allen Kontierungsinformationen für den Beschaffungsprozess versehen sein.
Mit der Erfassung von Lieferscheinmengen kann die zeitgerechte Kostenbelastung der Baustelle erfolgen und die Rechnungsprüfung ist hausintern komplett vorbereitet. Die programmtechnischen Möglichkeiten hierzu bestehen seit Jahren, werden jedoch von kaum einem Unternehmen eingesetzt. Gerade hier ist die fehlende ganzheitliche Organisation der Geschäftsprozesse und des Datenflusses in den Unternehmen der Hemmschuh.
Die Umsetzung im Unternehmen
Die Realisierung des digitalen Betriebsablaufes kann nicht im „Big Bang“, also auf einen Schlag erfolgen. Sie ist ein Prozess, in den in einem Unternehmen alle Entscheidungsträger und Mitarbeiter einbezogen werden müssen. Es reicht nicht, dies an Stabsstellen zu delegieren. Die Bedeutung der Information als Wettbewerbsfaktor ist Aufgabe der absoluten Führungsebene des Unternehmens.
Der digitale Betriebsablauf setzt eindeutig definierte, praxisorientiert organisierte Geschäftsprozesse voraus. Diese bilden die Spielregeln für das Erzeugen, Strukturieren, Speichern und Auswerten aller Informationen. Gewachsene Organisationsstrukturen müssen dabei neu überdacht werden.
Zusammenfassung
Die Nutzung der Informationskette „Der digitale Betriebsablauf“ ist ein entscheidender Aspekt des Controllings im Unternehmen. Die Informationskette unterstützt alle Projektzyklen, das Zusammenarbeiten aller am Projekt Beteiligten und die Unternehmenssicht. „Der digitale Betriebsablauf“ setzt die ganzheitliche und umfassende Organisation der Informationen und damit der Geschäftsprozesse voraus. Bei der Strukturierung der Informationen stehen die Anforderungen aus der Praxis, nicht das Einhalten von Normen im Vordergrund.
Die Chancen
Die Umsetzung des Konzeptes „Der digitale Betriebsablauf“ bedeutet für die Unternehmen Aufbau des Know-hows für die Organisation strukturierter Informationen und einer damit verbunden durchgängigen Organisation der Geschäftsprozesse. Im Rahmen des Projektzyklusses setzt der digitale Betriebsablauf die Verfügbarkeit aller graphischen und alphanumerischen Informationen in digitaler Form voraus. Hier sind Auftraggeber gefordert. Das aus diesen Organisationsformen gewonnene Know-how gibt der deutschen Industrie die Chance, im internationalen Wettbewerb eine führende Rolle beim Wissensmanagement einzunehmen.
